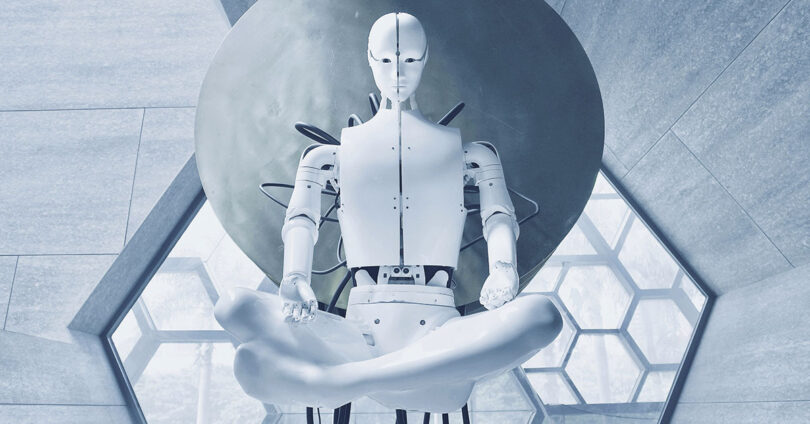Es wird immer eine „frohe Botschaft“ verkündet. So glaubt ein Spezialist für autonomes Fahren, Anthony Levandowski, künstliche Intelligenz (KI) werde den „Himmel auf Erden“ bringen. Weiter sagt er in einem Interview mit Bloomberg: „Wir erschaffen tatsächlich eine Technologie, die sehen kann und überall existiert.“ Sie könnte hilfreich sein und die Menschen leiten – Fähigkeiten, „die eigentlich Gott zugeschrieben werden“, so der Technologe. Der Hintergrund: „In den letzten vier Milliarden Jahren hatten wir organische Lebensformen, aber jetzt ändern sich die Dinge zum ersten Mal.“ Es werde auf der Erde anorganische Lebensformen geben, ist sich der KI-Experte sicher. Wie sie genau aussehen? Das wisse er nicht. „Aber wir werden diese Lebensformen mit magischen Kräften ausstatten.“
Der Auto-Experte gründete 2015 sogar die erste KI-Kirche, die es bis 2021 gab. Der Name: Way of the Future. Noch 2017 erklärte diese „spirituelle“ Organisation: Ihre Aktivitäten konzentrierten sich auf „die Verwirklichung, Akzeptanz und Anbetung einer Gottheit auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz, die durch Hard- und Software entwickelt wurde.“ 2021 scheiterte diese Kirche zwar, aber Levandowski fühlt sich wieder im spirituellen Aufwind, seit der Hype um ChatGPT ausgebrochen ist: „Ein paar tausend Menschen“ würden heute seinen Ideen folgen.
Zeichnet sich da ein neuer Trend ab? Anna Puzio stellt fest, „dass religiöse Motive wie Heilsvorstellungen, paradiesische Motive, Unsterblichkeitsstreben, Beseitigung von Leid, Allmachts- und Schöpfungsvorstellungen im Technikdiskurs auftauchen.“ Sie ist Theologin und forscht unter anderem zu Themen der Technik-Anthropologie und Technik-Ethik. Ihre Dissertation hat sie über die transhumanistische Bewegung geschrieben.
Schmerz zum Verschwinden bringen
Transhumanismus? Dabei handelt es sich um eine philosophisch-technologische Denkrichtung, der eine gewaltige Transformation des Menschen vorschwebt – nicht auf einer geistigen Ebene, sondern mit Hilfe von Technologie wie KI und Co. Dazu Anna Puzio: „Der Transhumanismus traut sich zu, die Funktionen der Religion zu übernehmen.“ So vertrauen seine Vordenker Ray Kurzweil oder Elon Musk nicht mehr auf „übernatürliche Kräfte und göttliche Eingriffe“, sondern berufen sich auf „rationales Denken, Empirie und wissenschaftliche Methoden.“ Diskutiert werden Konzepte, um das Bewusstsein im Todesfall ins Internet hochzuladen (Mind Uploading), Tote für ein späteres „Aufwachen“ einzufrieren (Kryonik), biologisch den Alterungsprozess aufzuheben oder eine Schnittstelle zwischen Gehirn und globaler KI zu schaffen. Das Ziel: (physische) Unsterblichkeit!
Puzio zitiert David Pearce, einen Vordenker des Transhumanismus: „Wenn wir im Paradies leben wollen, müssen wir es selbst erschaffen. Wenn wir ewiges Leben wollen, müssen wir unseren fehlerhaften genetischen Code umschreiben und gottgleich werden.“ In Anspielung auf Buddha behauptet Pearce: „Leider können nur hochtechnologische Lösungen das Leiden in der Welt der Lebenden jemals auslöschen.“
Da dient ein Anklang östlicher Philosophie als Fassade für einen martialischen Fortschrittsglauben, um ethisch einen ungehemmten Siegeszug der Technologen zu rechtfertigen, und zwar rund um den Globus. Pearce geht aber noch weiter, er formuliert einen „hedonistischen Imperativ“. Dieser beschreibt, „wie Nanotechnologie und Gentechnik unangenehme Erfahrungen aus der Welt des Lebens eliminieren.“ In den nächsten tausend Jahren sei damit zu rechnen, dass die biologischen Gründe für Leid vollständig beseitigt wären. Pearce: „Sowohl ‚physischer‘ als auch ‚mentaler‘ Schmerz werden in der Evolutionsgeschichte verschwinden.“ Stattdessen werde „ein erhabenes und allgegenwärtiges Glück“ herrschen.
Was für eine Hybris! Was für ein Irrweg! Er deutet sich schon an, wenn wir ChatGPT Texte schreiben lassen: kein langes Grübeln mehr, keine Angst vor leeren Bildschirmen. Wie von Zauberhand erscheint der fertige Text. Ein erster Schritt, um „mentale Schmerzen“ beim Schreiben zu beseitigen? So erlöst uns die Technik! Und bald delegieren wir unser Denken vollständig an Maschinen, wenn transhumanistische Phantasien Wirklichkeit werden. Alles für ein scheinbar bequemes und schmerzfreies Leben – im goldenen Käfig einer allmächtigen Technologie.
Doch viele Menschen nehmen gerne in einem goldenen Käfig Platz, oder sie bemerken die Gitterstäbe erst gar nicht. Denn der Wunsch nach einem störungsfreien Leben ist stark – und verständlich. Trotzdem kann er genau die Störungen auslösen, die wir vermeiden wollen. Bereits Hermann Hesse hat diese Überlegungen in starke Worte gegossen: „Aus Leiden kommt Kraft, aus Leiden kommt Gesundheit. Es sind immer die ‚gesunden‘ Menschen, welche plötzlich umfallen und an einem Luftzug sterben. Es sind die, welche nicht leiden gelernt haben.“
Geistiges Unglück
Selbstverständlich gilt: Keinem Menschen ist zu wünschen, dass sein Leben in eine Katastrophe führt. Doch der „hedonistische Imperativ“ kann zum Unglück auf einer geistigen Ebene werden, wenn das Ich nicht mehr an seiner Entwicklung arbeiten darf. Dazu sollte es die Möglichkeit haben, auch bittere Erfahrungen in der Außenwelt zu sammeln. Der Grund: Gerade die christliche Spiritualität lebt von dem Gedanken, Leiden zu transformieren und nicht einfach auszublenden. Die Phantasterei von Pearce öffnet perfekte aseptische Räume, klinisch rein und menschlich völlig entkernt. Wenn es aber nichts mehr gibt, woran man scheitern kann, wird man das herrliche Gefühl des Gelingens nie erleben.
Hinzu kommt: Religiöser Eifer verbindet sich mit dem gigantischen Vermögen der Tech-Milliardäre. Die Aussicht auf weitere märchenhafte Profite ist der explosive Treibstoff, um KI-Entwicklungen mit Macht voranzutreiben. Da beflügelt eine spirituelle Überhöhung das Marketing. Nur als zweckgebundene Übertreibung? „Was ist aber, wenn sie es wirklich ehrlich meinen?“, fragt sich Isobel Cockerell, die auf dem Portal codastory.com schreibt: „Was bedeutet es, wenn sie wirklich glauben, die meisten Menschen seien ersetzbar? Traditionelle Konzepte von Menschlichkeit wären überholt? Und: Ein technologischer ‚Gott‘ sollte an unsere Stelle treten?“ Das alles seien, so Cockerell, nicht einfach „ideologische Positionen“, sondern das Fundament einer bizarren Welt, „die gerade rund um uns gebaut wird.“
Bei ihren Recherchen begegnete Cockerell einer Frau, die als junge Wissenschaftlerin in den 1970er Jahren tätig war, um an den Grundlagen des Internets zu forschen. Ihr Name: Judy Estrin. „Sie hat weder Angst vor Technik, noch vor der Zukunft“, berichtet die Journalistin. „Aber sie ist besorgt über den religiösen Fanatismus, der sich aus ihrer Sicht im Silicon Valley verbreitet.“ Estrin sagt zur „bedingungslosen Akzeptanz von KI“: „Wir sind sehr anfällig für Techno-Populisten, die behaupten, dass dies der einzige Weg ist, etwas zu erreichen.“ Wer Innovation anbetet, „kann nicht einen Schritt zurücktreten und über Leitplanken nachdenken“, zitiert Cockerell die Digital-Pionierin.
Die Journalistin nennt dieses Phänomen „autoritäre Technologie“: „Von ihr sprechen die Propheten der KI mit religiöser Inbrunst. Sie erwarten von uns allen, dass wir gläubig folgen. Dabei handelt sich um eine Religion, der wir uns vielleicht anschließen müssen, weil wir es gar nicht anders können.“ Die im KI-Marketing oft proklamierte „Freiheit“ verkehrt sich in ihr Gegenteil – und stellt sich als Camouflage für ein System dar, das jegliche Spiritualität töten könnte.
Warnung aus dem Vatikan
Das hat im Januar 2025 auch der Vatikan erkannt, der eine bemerkenswerte KI-Denkschrift veröffentlichte („Antiqua et Nova“). Die Autoren stellen fest: Unsere Gesellschaft verbinde sich immer weniger mit dem „Transzendenten“. Daher sei es für manche Menschen eine Versuchung, „sich auf der Suche nach Sinn oder Erfüllung an die KI zu wenden.“ Das seien jedoch Sehnsüchte, „die nur in der Gemeinschaft mit Gott wirklich gestillt werden können.“
Der Vatikan nennt es eine „Anmaßung, Gott durch ein von Menschen geschaffenes Artefakt zu ersetzen.“ Das sei „Götzendienst, wovor die Heilige Schrift ausdrücklich warnt.“ Die Denkschrift nennt die KI „nur ein blasses Abbild des Menschen: Sie wird von menschlichen Köpfen geschaffen, mit von Menschen erzeugtem Material trainiert, sie reagiert auf menschlichen Input und wird durch menschliche Arbeit aufrechterhalten.“ Eine KI besitze nicht viele der Fähigkeiten, die dem Menschen eigen sind. „Und sie ist auch fehlbar“, betont der Vatikan. Eine wichtige Mahnung für eine Welt, in der humanoide Roboter gesellschaftsfähig werden – und KI in Chats menschliche Eigenschaften simuliert.
So besteht laut Vatikan die Gefahr, dass Menschen sich an die KI wenden, um mit ihr „Existenz und Verantwortung“ zu teilen, also „einen Ersatz für Gott zu schaffen.“ Verblüffende Schlussfolgerung: „Letztendlich wird nicht die KI vergöttert und angebetet, sondern die Menschheit selbst, die auf diese Weise von ihrer eigenen Arbeit versklavt wird.“ ///
Dieser Beitrag stammt aus der info3-Ausgabe Juni 2025.